Warum braucht es StoP
Fakten, Hintergründe
Sabine Stövesand über StoP
Anlässlich des 10-jähriges Jubiläum des Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe Frauen gegen Gewalt e.V. (bff) sprach Sabine Stövesand über das StoP-Projekt. In diesem Rahmen fand am 2.11.2015 ein Kongress mit dem Titel „Erfahrung – Debatte – Veränderung Entwicklungen zum Thema Gewalt im Geschlechterverhältnis“ im Abgeordnetenhaus in Berlin statt.
Kurzfassung
Das Projekt StoP hat sich zum Ziel gesetzt, Gewaltbetroffene und soziale Netzwerke in Stadtteilen so zu stärken, dass Partnergewalt nicht mehr erduldet, verschwiegen, ignoriert oder toleriert wird.
Partnergewalt ist kein neues, aber immer noch ein sehr unsichtbares Thema. Jede 4. Frau in Deutschland erlebt laut einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2004 in einer Partnerschaft Gewalt. Jeder dritten Frau begegnet psychische Gewalt, wie zum Beispiel die extreme Kontrolle des Freizeitverhaltens durch den Partner. Fast jede siebte Frau wird Opfer sexueller Gewalt. Aber: Scham oder fehlende Informationen hindern Betroffene darüber zu sprechen, sich Hilfe zu holen oder die Polizei anzurufen. Wenn hier die aufmerksame und informierte Nachbarschaft Hilfe anbietet, wenn das Thema Partnergewalt öffentlich angesprochen wird, dann kann Gesundheit und Leben gerettet werden.
Vertiefung
Auf welches Problem reagiert StoP?
Laut zahlreichen Studien aus verschiedenen Ländern (vgl. UNDFW 2007) ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen die weltweit am häufigsten vorkommende Menschenrechtsverletzung. Auch eine repräsentative Studie aus Deutschland (BMFSFJ 2004) hat ergeben, dass jede zweite bis dritte Frau nach dem 16. Lebensjahr körperlicher Gewalt oder Übergriffe erlebt hat, fast jeder 7. widerfuhr sexualisierte Gewalt nach strafrechtlich anerkannten Definitionen.

Betroffen sind Frauen aller Altersgruppen und sozialer Schichten! So beziehen fast 70 Prozent der Frauen, die von schweren körperlichen, psychischen und sexuellen Misshandlungen betroffen sind, ein
eigenes Einkommen, mehr als ein Drittel der misshandelten Frauen haben (Fach-)Abitur, Studium oder Meisterabschlüsse und nur drei Prozent der Männer, die ihre Frau schwer misshandeln, haben weder einen Schul-, noch Ausbildungsabschluss, aber 37 Prozent der Täter verfügen über die höchsten Bildungs- und Ausbildungsgrade. (http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=120792.html).
Jede vierte Frau erlebt Gewalt im Rahmen ihrer Partnerschaft. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Taten in den eigenen vier Wänden stattfindet. Doch diese Gewalt ist keine Privatangelegenheit, sie ist kein individuelles, sondern ein allgemeines Problem und verletzt in der Regel folgende Menschenrechtsartikel: Jede und jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit (Art.3) und darauf, keiner Folter oder unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung ausgesetzt zu sein (Art. 5); jede und jeder hat das Recht den Aufenthaltsort selbst zu bestimmen und sich frei bewegen zu können (Art. 13), das Recht, auf Freiwilligkeit der Eheschließung und das Recht auf Gleichberechtigung innerhalb der Familie (Art. 16) sowie das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Arbeit gegen Gewalt an Mädchen und Frauen ist also Menschenrechtsarbeit.
Unterstützungslücke
In den letzten Jahrzehnten sind viele Maßnahmen ergriffen worden, um die Gewaltopfer zu unterstützen und die Situation zu verändern: Frauenhäuser, Öffentlichkeitskampagnen, Fortbildungen, Männerprojekte, Arbeit mit Tätern, Bundesaktionspläne, Gesetzesnovellen.
Die Maßnahmen richten sich in der Regel entweder an Opfer, Täter, Fachleute aus verschiedenen Bereichen oder eine allgemeine Öffentlichkeit. Vernachlässigt wurde bislang eine entscheidende Größe: das sozial-räumliche Umfeld von Opfern und Tätern.
 Experten formulieren aufgrund von Erfahrungen aus jahrelanger Einzel- und Gruppenarbeit mit gewalttätigen Männern im Kontext der Jugend- und Bewährungshilfe: „Die gängigen Präventionsprogramme folgen weitgehend der Täter-Opfer-Logik. Eine dritte Systemgröße wird dabei meist vernachlässigt – die Position des/der Zeugen“ (Stiels-Glenn/Witt 2000) Der Begriff „Zeuge“ meint hier „die außenstehenden Menschen, die in einem Geschehen nicht vordergründig aktiv handelnd (Täter) oder erleidend (Opfer) sind, aber anwesend sind und das Geschehen sehen und hören. Diese außenstehenden Personen beeinflussen gleichwohl die Dynamik der Handlungen zwischen Opfer und Täter“ (ebd.: 22).
Experten formulieren aufgrund von Erfahrungen aus jahrelanger Einzel- und Gruppenarbeit mit gewalttätigen Männern im Kontext der Jugend- und Bewährungshilfe: „Die gängigen Präventionsprogramme folgen weitgehend der Täter-Opfer-Logik. Eine dritte Systemgröße wird dabei meist vernachlässigt – die Position des/der Zeugen“ (Stiels-Glenn/Witt 2000) Der Begriff „Zeuge“ meint hier „die außenstehenden Menschen, die in einem Geschehen nicht vordergründig aktiv handelnd (Täter) oder erleidend (Opfer) sind, aber anwesend sind und das Geschehen sehen und hören. Diese außenstehenden Personen beeinflussen gleichwohl die Dynamik der Handlungen zwischen Opfer und Täter“ (ebd.: 22).
Handlungsstrategien müssen vermehrt dort ansetzen, wo die Gewalt stattfindet, also direkt im unmittelbaren Lebensbereich der Menschen. An dieser Stelle existiert eine Lücke in Bezug auf den Schutz vor und den Abbau von Gewalt gegen Frauen, die gerade im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Gewaltschutzgesetzes noch zu schließen wäre. Damit die neuen rechtlichen Möglichkeiten, wie sie das Gewaltschutzgesetz bietet, zur Anwendung kommen, müssen sie verknüpft werden mit der Förderung nachhaltiger Unterstützungsstrukturen im sozialen Umfeld. Denn obwohl die Regelungen des Gewaltschutzgesetzes darauf abzielen, den Gewaltbetroffenen den Verbleib in der Wohnung zu ermöglichen, suchen viele nach wie vor Schutz in Frauenhäusern und/oder nehmen einen Umzug auf sich. Viele Frauen fühlen sich am bisherigen Wohnort ungeschützt, bzw. sind real gefährdet, weil sie isoliert und allein auf sich gestellt sind, weil der gewalttätige Partner sich möglicherweise nicht an die Wegweisung hält, weil er ihre und die Wege der Kinder kennt oder in der Nachbarschaft Verbündete hat.
Hier müssen zivilgesellschaftliche Mechanismen entwickelt  werden, die den Betroffenen Schutz bieten. Polizei oder Soziale Arbeit können und sollen Menschen nicht rund um die Uhr bewachen bzw. unterstützen, staatliche Strafverfolgung und professionelle Hilfe sind immer Teil eines Ausnahmezustands und nicht der alltäglichen Lebensbewältigung.
werden, die den Betroffenen Schutz bieten. Polizei oder Soziale Arbeit können und sollen Menschen nicht rund um die Uhr bewachen bzw. unterstützen, staatliche Strafverfolgung und professionelle Hilfe sind immer Teil eines Ausnahmezustands und nicht der alltäglichen Lebensbewältigung.
Es braucht einen Handlungsansatz, der auf den Aufbau bzw. die Stabilisierung sozialer Kontakte und Netzwerke abzielt und sie dahingehend unterstützt, den Opfern Rückhalt zu geben, so dass diese ihre Rechte ausschöpfen. Es braucht einen Ansatz, der die Flucht perspektivisch überflüssig macht, weil die Betroffenen sich vor Ort sicher fühlen.
Ihnen, die nicht direkt involviert sind, stehen häufig wichtige Handlungsoptionen offen, sie können dazu beitragen, Eskalationen zu verhindern oder die Gewalt zu stoppen.
Gemeinwesenarbeit als Handlungsrahmen
StoP konzentriert sich auf das Gemeinwesen und möchte einen offenen Umgang mit dem Thema Partnergewalt schaffen und das Potenzial sozialer, lokaler Nahräume nutzen, denn: Nachbarn und Nachbarinnen haben u.a. den Vorteil kurzer Wege. Sie sind in Krisensituationen schnell erreichbar. In der Regel sind sie zumeist auch selbst direkt oder indirekt beteiligt (hören, sehen, ahnen…) und fühlen sich teilweise direkt betroffen (Ärger, Angst, Irritation, Sorge, Empathie). Sie können dazu beitragen, Eskalationen zu verhindern und Gewalt zu stoppen! Studien (Browning 2002) belegen, dass eine aufgeklärte und handlungswillige Nachbarschaft lebensrettend und gewaltreduzierend wirken kann.
Nachbarn und Nachbarinnen haben u.a. den Vorteil kurzer Wege. Sie sind in Krisensituationen schnell erreichbar. In der Regel sind sie zumeist auch selbst direkt oder indirekt beteiligt (hören, sehen, ahnen…) und fühlen sich teilweise direkt betroffen (Ärger, Angst, Irritation, Sorge, Empathie). Sie können dazu beitragen, Eskalationen zu verhindern und Gewalt zu stoppen! Studien (Browning 2002) belegen, dass eine aufgeklärte und handlungswillige Nachbarschaft lebensrettend und gewaltreduzierend wirken kann.
Hier setzt der nachbarschaftsbezogene Interventionsansatz von StoP an! Hier wird eine klassische Methode der Sozialen Arbeit, die Gemeinwesenarbeit, auf ein neues Handlungsfeld, die Arbeit gegen Partnergewalt, angewandt. Das hat für Deutschland innovativen und beispielhaften Charakter. Gemeinwesenarbeit verbindet individuelle Unterstützungsmaßnahmen mit sozial-strukturellen Entwicklungsprozessen. Ein Kernelement ist die Aktivierung der Menschen und die Förderung der Selbstorganisation im Sinne eines Empowerments, das sowohl Bildungsprozesse als auch kollektive Durchsetzungsstrategien umfasst. Die Schaffung von Beziehungen zwischen verschiedenen lokalen AkteurInnen und die Förderung und Nutzung sozialer Netzwerke sind zentrale Punkte. Mit diesem Ansatz sollen soziale Veränderung in Richtung von Gewaltfreiheit und gegenseitiger Unterstützung, ausgehend von der Ebene des lokalen Gemeinwesens, angeregt und entsprechende Strukturen aufgebaut werden.
Grundlage für solch eine gemeinwesenbezogene Arbeit mit Nachbarschaften und sozialen Bezügen wäre ein Demokratieverständnis, welches das Recht auf eine unverletzbare Persönlichkeit, einschließlich der körperlichen Selbstbestimmung beinhaltet und das „an der Idee einer zivilen Gesellschaft anknüpft, welche die Privatsphäre in ihre Gerechtigkeitsvorstellungen einbezieht“ (Brückner 2000: 10).
Ziele
Die doppelte Zielsetzung von StoP besteht darin, 1. die Veröffentlichungsbereitschaft Gewaltbetroffener und Gewaltausübender einerseits, sowie 2. die Interventionsbereitschaft und die Zivilcourage eines lokalen Gemeinwesens andererseits systematisch auf- bzw. auszubauen. Dies meint dabei neben direkten Formen von Unterstützung und Einmischung auch die Bereitschaft und das Vermögen der BewohnerInnen sich weitergehend sozial- und gesellschaftspolitisch mit der Thematik auseinander zu setzen und kollektive Handlungsformen und Netzwerke zu entwickeln.
Beides, Veröffentlichungs- und Interventionsbereitschaft, sind keine rein persönlichen Haltungen, sondern durch miteinander verknüpfte strukturelle, kulturelle und individuelle Faktoren geprägt, insbesondere sind sie bestimmt durch: 1. die soziale Lage/Ressourcen, 2. die vorherrschenden Normen und kulturellen Leit- und Selbstbilder, 3. die Sichtbarkeit der Gewalt, 4. das Interesse an der Nachbarschaft und die Existenz vertrauensvoller Beziehungen und 5. individuelle Motivationslagen, Ängste, Unsicherheiten und Kompetenzen. Alle diese Faktoren müssen berücksichtigt und bearbeitet werden. Das geht nur in einem Verbund von AkteurInnen der von der sozialen Stadtentwicklung über Bildungsarbeit bis hin zu engagierten BewohnerInnen reicht.
Handlungsleitende Orientierung
Die Arbeit mit dem StoP-Konzept sollte nicht von schablonenhaften Vorstellungen technischer Machbarkeit geleitet sein, sondern immer anhand der Bedingungen vor Ort konkretisiert werden. Diese Konkretisierung kann nur aufgrund einer genauen Kenntnis der Bedingungen und Beziehungsgeflechte vor Ort und der Problemdefinition und Interessen der BewohnerInnen erfolgen. Diese Kenntnis kann nur in direktem Kontakt mit den BewohnerInnen gewonnen werden und das Vorgehen muss entschieden von ihnen mitgetragen und mitbestimmt werden.
Wie sähe es aus, wenn StoP seine Ziele erreicht?
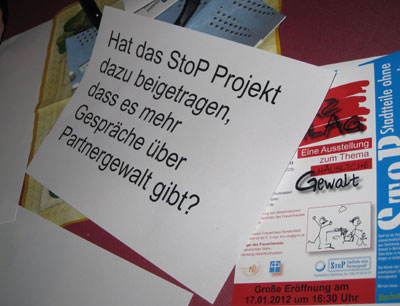 Langfristiges Ziel von StoP ist es, dass die Entstehung von Täterschaft verhindert wird und die Zahl der Gewalthandlungen im häuslichen Bereich sinkt.
Langfristiges Ziel von StoP ist es, dass die Entstehung von Täterschaft verhindert wird und die Zahl der Gewalthandlungen im häuslichen Bereich sinkt.
Aber auch schon früher treten Veränderungen zu tage: es findet ein Norm- und Wertewandel im Bereich kultureller Leitvorstellungen sowie privater und öffentlicher sozialer Beziehungen statt bezogen auf existierende Geschlechterstereotype, auf Gewaltfreiheit und Gleichberechtigung: Gewalt in Beziehungen gilt nicht mehr als Privatsache!
Außerdem ist Gewalt enttabuisiert und sichtbar: Gewaltbetroffene machen ihre Gewaltwiderfährnisse öffentlich, Gewalt im Geschlechterverhältnis wird in (lokalen) Medien und in Bildungs- und Freizeiteinrichtungen thematisiert.
Die Wissens- und Handlungsfähigkeit der BewohnerInnen und anderen Akteuren der Stadtteile sind gestärkt, sie sind für das Thema sensibilisiert und verfügen über und vermitteln entsprechendes Wissen und Informationen. Gewaltopfer nehmen professionelle Hilfe an und schämen sich ihrer Gewalterfahrungen nicht länger und sind in ein unterstützendes soziales Netz eingebunden. Professionelle in der Sozialen Arbeit, im Gesundheitsbereich und in des Strafverfolgung vor Ort beraten und unterstützen Gewaltopfer bezogen auf die Durchsetzung ihrer Rechte und betreiben die In-Verantwortungnahme der Täter, so dass Gerechtigkeit für die Gewaltopfer hergestellt wird.
 Die sozialen Netze funktionieren, denn NachbarInnen kennen einander, es findet Kommunikation statt und es besteht die Bereitschaft der gegenseitigen Unterstützung. Unterschiedliche Personen – MitarbeiterInnen von Institutionen, Gewerbetreibende und BewohnerInnen, Männer und Frauen aus dem lokalen Umfeld von Opfer und Täter mischen sich ein, wirken deeskalierend, rufen die Polizei, öffnen ihre Türen, bieten kurzfristig Unterschlupf organisieren Telefonketten und bieten Begleitung an.
Die sozialen Netze funktionieren, denn NachbarInnen kennen einander, es findet Kommunikation statt und es besteht die Bereitschaft der gegenseitigen Unterstützung. Unterschiedliche Personen – MitarbeiterInnen von Institutionen, Gewerbetreibende und BewohnerInnen, Männer und Frauen aus dem lokalen Umfeld von Opfer und Täter mischen sich ein, wirken deeskalierend, rufen die Polizei, öffnen ihre Türen, bieten kurzfristig Unterschlupf organisieren Telefonketten und bieten Begleitung an.
Die folgenden acht Umsetzungsschritte verdeutlichen das konkrete Vorgehen das Handlungskonzept im Stadtteil umzusetzen: 8 Schritte


